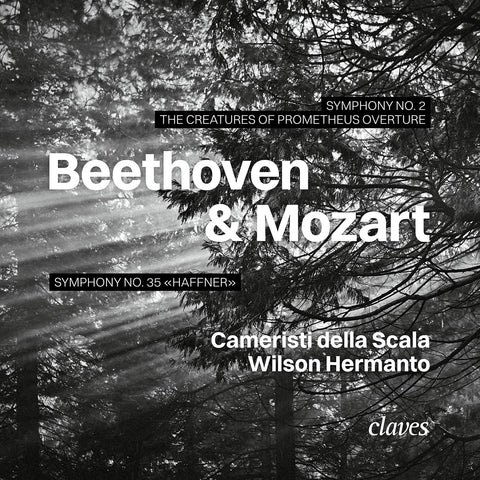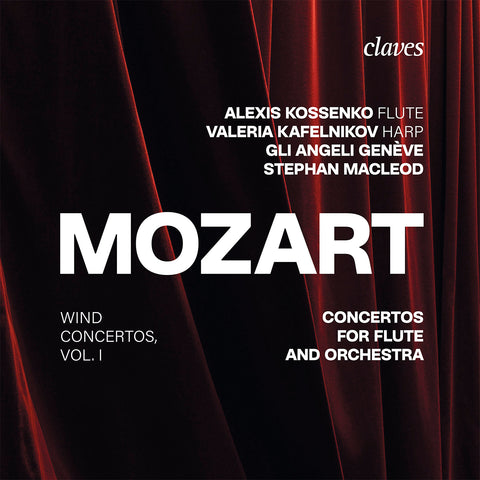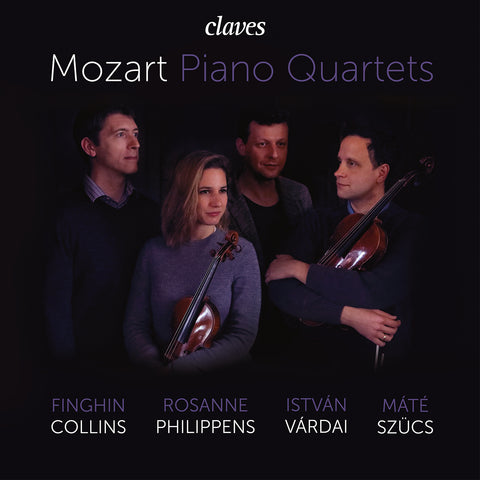(2025) «Vergehen» works by Haydn - Mozart - Kendall
Kategorie(n): Moderne Orchester Repertoire
Hauptkomponist: Diverse Komponisten (siehe Sammlungen)
Orchester: Musikkollegium Winterthur
Dirigent: Roberto González-Monjas
CD-Set: 1
Katalog Nr.:
CD 3113
Freigabe: 09.05.2025
EAN/UPC: 7619931311326
(Wird einige Tage vor dem Veröffentlichungsdatum verschickt).
Dieses Album ist jetzt neu aufgelegt worden. Bestellen Sie es jetzt zum Sonderpreis vor.
CHF 18.50
Dieses Album ist nicht mehr auf CD erhältlich.
Dieses Album ist noch nicht veröffentlicht worden. Bestellen Sie es jetzt vor.
CHF 18.50
Dieses Album ist nicht mehr auf CD erhältlich.
CHF 18.50
Inklusive MwSt. für die Schweiz und die EU
Kostenloser Versand
Dieses Album ist nicht mehr auf CD erhältlich.
Inklusive MwSt. für die Schweiz und die EU
Kostenloser Versand
Dieses Album ist jetzt neu aufgelegt worden. Bestellen Sie es jetzt zum Sonderpreis vor.
CHF 18.50
Dieses Album ist nicht mehr auf CD erhältlich.
This album has not been released yet.
Pre-order it at a special price now.
CHF 18.50
Dieses Album ist nicht mehr auf CD erhältlich.
CHF 18.50
Dieses Album ist nicht mehr auf CD erhältlich.
NEU: Einkäufe werden von nun an in der Währung Ihres Landes getätigt. Land hier ändern oder beim Checkout
SPOTIFY
(Verbinden Sie sich mit Ihrem Konto und aktualisieren die Seite, um das komplette Album zu hören)
«VERGEHEN» WORKS BY HAYDN - MOZART - KENDALL
ROBERTO GONZÁLEZ-MONJAS ÜBER MOZARTS BLICK IN DIE UNENDLICHKEIT
Die drei Sinfonien, die Mozart in zwei Sommermonaten des Jahres 1788 komponiert hat, haben Roberto González-Monjas dazu inspiriert, drei Konzertsaisons um diese Dreiergruppe zu planen. Drei unvergleichlich kunstvoll gemachte Werke sind es, die eine Fülle menschlicher Erfahrungen und existentieller Bedingungen widerspiegeln. González-Monjas und sein Team beim Musikkollegium Winterthur haben lange überlegt, wie die in Mozarts Sinfonien-Trias angelegten Dimensionen in Begriffe zu fassen sind. Am Ende hat er sich für «Werden – Sein – Vergehen» entschieden, was sofort einleuchtet: Dem ersten der drei Werke, der Es-Dur-Sinfonie (Nr. 39, Claves CD 3076) mit ihrer grossen Einleitung, wohnt überall Frische und Anfang inne; die g-Moll-Sinfonie (Nr. 40, Claves CD 3099) hingegen wirft uns ohne Vorwarnung mitten in den Gefühlsaufruhr des menschlichen Daseins. Mozarts letzte Sinfonie, die sogenannte «Jupiter-Sinfonie» in C-Dur (Nr. 41) schliesslich ist ganz auf ihr Ende, die atemberaubende Coda des Finales ausgerichtet.
AUCH DAS SCHÖNE MUSS STERBEN
So stand beim Musikkollegium Winterthur die Konzertsaison 2024/25 im Zeichen des «Vergehens». Abschied und Trauer, Verlust und Schmerz sind seit jeher Themen, die bei der Kunstform Musik gut aufgehoben sind. Musik kann Trost spenden wie in Mozarts Requiem, sie kann meditativer Umgang mit der Ewigkeit sein wie im «Abschied» aus Mahlers «Lied von der Erde». Sie kann unserer Furcht vor dem Ende Ausdruck verleihen wie Frank Martins Jedermann-Monologe oder dem Schmerz Ausdruck verleihen wie Tschaikowskis Pathétique, deren Schlusssatz vielleicht fast so etwas wie ein Plädoyer für die Untröstlichkeit darstellt. Alles Werke übrigens, die Roberto González-Monjas und das Musikkollegium Winterthur folgerichtig ins Saisonprogramm aufgenommen hatten.
Und stets ist jede Musik selbst «Vergehen», als Zeitkunst mit der Vergänglichkeit unlösbar verbunden. Friedrich Schiller hat in seiner Elegie «Nänie» – die Vertonung durch Johannes Brahms erklang ebenfalls in der Saison 2024/25 – die Vergänglichkeit aller Kunst rücksichtlos zu Ende gedacht: «Auch das Schöne muss sterben», heisst es bei Schiller. Dass «das Schöne vergeht, dass das Vollkommene stirbt» bedeutet in letzter Konsequenz, dass eines Tages, spätestens mit dem Ende der Menschheit, sogar Mozarts wundervolle Sinfonien verschwinden. Einen Trost bietet Schiller der Kunst an, nämlich denjenigen, ein herrliches «Klaglied zu sein» – während das Gewöhnliche bloss «klanglos zum Orkus hinab» gehe.
DENKEN – FÜHLEN – GLAUBEN
Mozarts Jupiter-Sinfonie repräsentiert als letztes Werk der sinfonischen Trias zwar das «Vergehen». Aber sie ist kein Klagelied im direkten Sinne, sondern ein ungemein heiteres, gefasstes, geistsprühendes C-Dur-Werk. González-Monjas erklärt, dass Mozart bewusst Kirchenstil und -pracht in die Sinfonik einbeziehe und so eine spirituelle, metaphysische Komponente ins Spiel bringe.
Nach Mozarts aufklärerischen, vernunftorientierten Idealen, wie sie sich besonders in der Es-Dur-Sinfonie (Nr. 39) zeigten, und den aus seiner Opernerfahrung gewonnenen psychologischen Einsichten in der g-Moll- Sinfonie (Nr. 40) weite Mozart in der letzten Sinfonie (Nr. 41) noch einmal den Kreis, so González-Monjas. Mozarts sinfonische Trias liesse sich darum auch unter die Begriffe «Denken – Fühlen – Glauben» fassen, oder anders: «Erkenntnis – Erfahrung – Erleuchtung». Geist und Körper, Vernunft und Emotion sollen im dritten Schritt nicht nur in ihren Möglichkeiten übertroffen, sondern gleichsam versöhnt, ihre Widersprüche gelöst werden. «Unschuld – Sünde – Erlösung» lautete denn ein weiterer Vorschlag von González-Monjas.
Glaube, Erleuchtung, Erlösung sind religiöse Begriffe, und tatsächlich evoziert Mozart das Göttliche im Finale der Jupiter-Sinfonie. Nicht nur mit Fugentechnik und Kontrapunkt, sondern auch im thematischen Gehalt: Die Vierton-Folge, die den ganzen Finalsatz prägt, hat Mozart zuvor in Messkompositionen verwendet. Einmal zu den Worten «credo, credo», einmal zu «sanctus, sanctus». Selbst wer dies nicht weiss, fühlt wahrscheinlich, was jenseits der Sprache gemeint ist – so mottohaft-sprechend ist die Tonfolge.
AN DER GRENZE DES MÖGLICHEN
Im Sinfoniefinale ist die Tonfolge Hauptthema eines Sonatensatzes, also eines musikalischen Geschehens aus Dynamik und Ruhe und Erfüllung (wir könnten auch sagen: aus Werden, Sein und Vergehen). Und dann, als der Sonatensatz eigentlich zu Ende ist, eröffnet die Vierton- Folge – nun kopfüber hängend, harmonisch rätselhaft und im piano – die berühmte Coda, in der Mozart uns seine ganze Kunst zeigen will. Alle Themen des Satzes kombiniert er kontinuierlich, bis er alles zu einer Art «kompaktem Würfel» gefügt hat, wie es der Musikwissenschaftler Peter Gülke formuliert. So staunenswert dies ist – musikalischer Fortgang, gestaltete Zeit wie im Sonatensatz zuvor, seien so nicht mehr möglich; Mozart «komponiert an die Grenze des hier Möglichen heran, jenseits ihrer gibt es nichts zu holen» (Gülke).
Die Klimax leuchtet nur kurz auf, ohne Bombast; bald löst sich der «Würfel», und der Satz schliesst heiter. Zuvor aber haben wir vielleicht kurz in die Unendlichkeit geblinzelt, in den wenigen Takten, wo Mozart es schafft, höchste Kunstfertigkeit und mitreissende Musik, Denken und Fühlen, Werden und Vergehen zusammenzubringen. Zugegeben, am Vergehen der Zeit ändert das nichts. Aber lassen wir uns doch von Peter Gülke dazu ermutigen, «in grossen Momenten der Musik Unabhängigkeit vom gefrässigen Zeitlauf mitzuhören».
Felix MichelHANNAH KENDALL
He stretches out the north over the void and hangs the earth on nothing
«He stretches out the north over the void and hangs the earth on nothing» (Er streckt den Norden über die Leere aus und hängt die Erde an das Nichts) ist sowohl von Schumanns Sinfonie Nr. 2 als auch von Mozarts «Jupiter»-Sinfonie inspiriert, was mich zu dem Titel führte; dieser ist eine Passage aus dem Buch Hiob, in der über die Grösse und Macht Gottes nachgedacht wird, mit spezifischen Bildern, die sich auf die wundersame Schöpfung des endlosen Kosmos beziehen. Sie erinnerte mich an Jupiter, den Gott des Himmels und des Donners (in einigen Übersetzungen ist «der Norden» gleichbedeutend mit «der nördliche Himmel», und später heisst es in dem Vers: «Wer kann dann den Donner seiner Macht verstehen?»). Sie schien jedoch auch die Empfindungen einer tiefen Verzweiflung zu verkörpern, die an diejenige von Schumann erinnerte, wie er sie in seinen Briefen ausdrückt: Das Gefühl, in einer Leere zu sein, ohne greifbaren Halt zu haben. Dies ist das übergreifende Thema, das ich mit dem Werk zu evozieren versucht habe. Genauer gesagt ist ein ausgedehnter erster Bläsersatz auf einer Reihe von Akkorden aus Schumanns Sinfonie aufgebaut. Tatsächlich werden Motive aus beiden Werken zitiert, und darüber hinaus spielt eine Sammlung vorprogrammierter Spieldosen Mozarts «Ah! vous dirai-je, Maman», ein Thema und Variationen über das englische Schlaflied «Twinkle Twinkle Little Star», das auf die Grenzenlosigkeit des Himmels verweist, aber vor allem nach Licht in einer scheinbar alles verzehrenden Dunkelheit verlangt.
Hannah Kendall
HANNAH KENDALL
Hannah Kendall, in London geboren, studierte Gesang und Komposition an der University of Exeter, wo sie im Hauptfach Gesang und Komposition abschloss. Ausserdem erwarb sie einen Master-Abschluss am Royal College of Music, wo sie bei Kenneth Hesketh studierte, sowie einen Master-Abschluss in Kunstmanagement am Royal Welsh College of Music and Drama in Cardiff. 2015 gewann Kendall einen «Women of the Future Award» in der Kategorie Kunst und Kultur. Im Rahmen des Schleswig-Holstein Musik Festivals wurde ihr der Hindemith-Preis 2022 verliehen aufgrund ihrer «enormen kompositorischen Vielfalt, die von klassischem Erbe bis hin zu experimentellen Ideen reiche». Dazu sagt Kendall: «Suggestive Bilder innerhalb dramatischer Konstrukte bilden die Hauptbestandteile meines Kompositionsstils. Manchmal greife ich auf Aspekte meines afrikanisch-karibisch-europäischen Erbes zurück. Ich versuche, Wege zu einem tieferen Verständnis zu finden, wie kulturelle Entdeckungen die Ästhetik meiner Musik beeinflussen können.»
ROBERTO GONZÁLEZ-MONJAS
Roberto González-Monjas ist ein äusserst gefragter Dirigent und Geiger, der sich international rasch einen Namen machte. Er ist Chefdirigent des Musikkollegium Winterthur und Chefdirigent des Mozarteumorchesters Salzburg. Zudem wirkt er als Erster Gastdirigent des Belgian National Orchestra und Chefdirigent des Symphonieorchesters von Galicien in Spanien. Die Dalasinfoniettan in Schweden ernannte ihn nach vier Jahren als Chefdirigent zum Ehrendirigenten. Als engagierter Pädagoge und Förderer einer neuen Generation talentierter Musiker hat Roberto González-Monjas zusammen mit dem Dirigenten Alejandro Posada 2013 die Iberacademy gegründet. Ihr Ziel ist es, ein effizientes und nachhaltiges Modell der musikalischen Ausbildung in Lateinamerika zu schaffen, das sich auf benachteiligte Bevölkerungsschichten konzentriert – und hochtalentierte junge Musiker:innen fördert. Er ist zudem Professor für Violine an der Guildhall School of Music & Drama und ist regelmässig Mentor und Dirigent des Guildhall School Chamber and Symphony Orchestra in der Barbican Hall, London. Zuvor war Roberto González-Monjas sechs Jahre lang Konzertmeister des Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia sowie bis zum Ende der Saison 2020/21 des Musikkollegium Winterthur.
MUSIKKOLLEGIUM WINTERTHUR
Das MMusikkollegium Winterthur wurde 1629 gegründet und ist somit eine der traditionsreichsten musikalischen Institutionen Europas. Winterthur ragt aus der europäischen Kulturlandschaft heraus. Dies nicht nur dank seiner Kunstsammlungen, sondern auch dank seines Orchesters – dem Musikkollegium Winterthur –, das seit 2021/22 unter der Leitung des Chefdirigenten Roberto González-Monjas steht. Die bis ins Jahr 1629 zurückreichende Geschichte des Musikkollegium Winterthur hat lebendige Spuren hinterlassen: Das Engagement der bürgerlichen Familien aus dem 17. Jahrhundert wird heute von den zahlreichen Vereinsmitgliedern weitergeführt.
Prägend ist insbesondere das frühe 20. Jahrhundert geworden. Der Mäzen Werner Reinhart und der Dirigent Hermann Scherchen machten Winterthur zu einem Zentrum des europäischen Musiklebens. Igor Strawinsky, Richard Strauss und Anton Webern verkehrten hier, auch Clara Haskil oder Wilhelm Furtwängler. Ein verpflichtendes Erbe: Kein anderes klassisches Sinfonieorchester der Schweiz widmet sich dem zeitgenössischen Musikschaffen so selbstverständlich wie das Musikkollegium Winterthur. Dazu kommen Uraufführungen, in jüngster Zeit von Richard Dubugnon, Helena Winkelman, David Philip Hefti, Matthias Pintscher, Andrea Tarrodi und Arash Safaian. Die weiteren Repertoire-Schwerpunkte liegen in der Klassik und frühen Romantik. Aber auch auf grosse Sinfonik – etwa von Brahms, dem eine neuere CD-Einspielung gilt – wirft das agile Orchester gerne frisches Licht. In Opern- und Ballettproduktionen ist es ebenfalls regelmässig zu erleben. Mit über 40 Saisonkonzerten, seinem vielseitigen Musikvermittlungs-Angebot sowie spartenübergreifenden Formaten tritt das Orchester hervor. Zur hohen Qualität des Klangkörpers beigetragen haben viele: ehemalige Chefdirigenten wie Franz Welser-Möst, Heinrich Schiff oder Thomas Zehetmair, langjährige Gastdirigenten wie Heinz Holliger, Reinhard Goebel und Michael Sanderling, aber auch international gefragte Solistinnen und Solisten, die stets gerne zum Musikkollegium Winterthur zurückkehren. So sind unter anderem Andreas Ottensamer, Barbara Hannigan, Sir András Schiff, Ian Bostridge oder Carolin Widmann regelmässig in Winterthur zu Gast.
ANDERE ALBEN AUS DIESER „SÉRIE“
„Auch wenn man Musik nicht vollständig verstehen muss, ist es faszinierend, die Geheimnisse hinter musikalischen Meisterwerken zu entschlüsseln.“
Das Thema unserer Saison 22/23, „Werden“, ist direkt aus Mozarts großartiger Symphonie Nr. 39 entnommen. Dieses Werk wird mit Begriffen wie Freimaurerei, Virtuosität, Natur, Geheimnis und Erleuchtung in Verbindung gebracht. Aber warum? Kann Musik diese Ideen wirklich ausdrücken, oder assoziieren wir nur willkürlich romantische Bedeutungen mit ihr? Wie können wir ein Manuskript interpretieren, das 1788 bei Kerzenlicht eilig mit Tinte auf Pergament geschrieben wurde? Ich lade Sie herzlich ein, sich mit den verborgenen Aspekten dieses faszinierenden Werks zu beschäftigen.
"Sein" Works by Mozart - Syrse - Haydn
by Mozart - Syrse - Haydn
Der Chefdirigent des Musikkollegiums Winterthur, Roberto González-Monjas, nahm die drei letzten Sinfonien, die Mozart im Sommer 1788 in rascher Folge komponierte, zum Anlass für dieses gross angelegte saisonale Triptychon. Während die erste Sinfonie (Nr. 39) in Es-Dur eine langsame Einleitung hat, endet die letzte (Nr. 41), die so genannte „Jupiter-Sinfonie“, mit einem atemberaubenden Finale, so dass „Anfang“ und „Ende“ - ja, sagen wir „Werden“ und „Überschreiten“ - zum künstlerischen Konzept dieser Trilogie gehören. Die zentrale g-Moll-Sinfonie (Nr. 40) steht für das „Sein“: für das „im Zentrum sein“.
[Weitere Alben des Musikkollegiums Winterthur anzeigen]
ROBERTO GONZÁLEZ-MONJAS ÜBER MOZARTS BLICK IN DIE UNENDLICHKEIT
Die drei Sinfonien, die Mozart in zwei Sommermonaten des Jahres 1788 komponiert hat, haben Roberto González-Monjas dazu inspiriert, drei Konzertsaisons um diese Dreiergruppe zu planen. Drei unvergleichlich kunstvoll gemachte Werke sind es, die eine Fülle menschlicher Erfahrungen und existentieller Bedingungen widerspiegeln. González-Monjas und sein Team beim Musikkollegium Winterthur haben lange überlegt, wie die in Mozarts Sinfonien-Trias angelegten Dimensionen in Begriffe zu fassen sind. Am Ende hat er sich für «Werden – Sein – Vergehen» entschieden, was sofort einleuchtet: Dem ersten der drei Werke, der Es-Dur-Sinfonie (Nr. 39, Claves CD 3076) mit ihrer grossen Einleitung, wohnt überall Frische und Anfang inne; die g-Moll-Sinfonie (Nr. 40, Claves CD 3099) hingegen wirft uns ohne Vorwarnung mitten in den Gefühlsaufruhr des menschlichen Daseins. Mozarts letzte Sinfonie, die sogenannte «Jupiter-Sinfonie» in C-Dur (Nr. 41) schliesslich ist ganz auf ihr Ende, die atemberaubende Coda des Finales ausgerichtet.
AUCH DAS SCHÖNE MUSS STERBEN
So stand beim Musikkollegium Winterthur die Konzertsaison 2024/25 im Zeichen des «Vergehens». Abschied und Trauer, Verlust und Schmerz sind seit jeher Themen, die bei der Kunstform Musik gut aufgehoben sind. Musik kann Trost spenden wie in Mozarts Requiem, sie kann meditativer Umgang mit der Ewigkeit sein wie im «Abschied» aus Mahlers «Lied von der Erde». Sie kann unserer Furcht vor dem Ende Ausdruck verleihen wie Frank Martins Jedermann-Monologe oder dem Schmerz Ausdruck verleihen wie Tschaikowskis Pathétique, deren Schlusssatz vielleicht fast so etwas wie ein Plädoyer für die Untröstlichkeit darstellt. Alles Werke übrigens, die Roberto González-Monjas und das Musikkollegium Winterthur folgerichtig ins Saisonprogramm aufgenommen hatten.
Und stets ist jede Musik selbst «Vergehen», als Zeitkunst mit der Vergänglichkeit unlösbar verbunden. Friedrich Schiller hat in seiner Elegie «Nänie» – die Vertonung durch Johannes Brahms erklang ebenfalls in der Saison 2024/25 – die Vergänglichkeit aller Kunst rücksichtlos zu Ende gedacht: «Auch das Schöne muss sterben», heisst es bei Schiller. Dass «das Schöne vergeht, dass das Vollkommene stirbt» bedeutet in letzter Konsequenz, dass eines Tages, spätestens mit dem Ende der Menschheit, sogar Mozarts wundervolle Sinfonien verschwinden. Einen Trost bietet Schiller der Kunst an, nämlich denjenigen, ein herrliches «Klaglied zu sein» – während das Gewöhnliche bloss «klanglos zum Orkus hinab» gehe.
DENKEN – FÜHLEN – GLAUBEN
Mozarts Jupiter-Sinfonie repräsentiert als letztes Werk der sinfonischen Trias zwar das «Vergehen». Aber sie ist kein Klagelied im direkten Sinne, sondern ein ungemein heiteres, gefasstes, geistsprühendes C-Dur-Werk. González-Monjas erklärt, dass Mozart bewusst Kirchenstil und -pracht in die Sinfonik einbeziehe und so eine spirituelle, metaphysische Komponente ins Spiel bringe.
Nach Mozarts aufklärerischen, vernunftorientierten Idealen, wie sie sich besonders in der Es-Dur-Sinfonie (Nr. 39) zeigten, und den aus seiner Opernerfahrung gewonnenen psychologischen Einsichten in der g-Moll- Sinfonie (Nr. 40) weite Mozart in der letzten Sinfonie (Nr. 41) noch einmal den Kreis, so González-Monjas. Mozarts sinfonische Trias liesse sich darum auch unter die Begriffe «Denken – Fühlen – Glauben» fassen, oder anders: «Erkenntnis – Erfahrung – Erleuchtung». Geist und Körper, Vernunft und Emotion sollen im dritten Schritt nicht nur in ihren Möglichkeiten übertroffen, sondern gleichsam versöhnt, ihre Widersprüche gelöst werden. «Unschuld – Sünde – Erlösung» lautete denn ein weiterer Vorschlag von González-Monjas.
Glaube, Erleuchtung, Erlösung sind religiöse Begriffe, und tatsächlich evoziert Mozart das Göttliche im Finale der Jupiter-Sinfonie. Nicht nur mit Fugentechnik und Kontrapunkt, sondern auch im thematischen Gehalt: Die Vierton-Folge, die den ganzen Finalsatz prägt, hat Mozart zuvor in Messkompositionen verwendet. Einmal zu den Worten «credo, credo», einmal zu «sanctus, sanctus». Selbst wer dies nicht weiss, fühlt wahrscheinlich, was jenseits der Sprache gemeint ist – so mottohaft-sprechend ist die Tonfolge.
AN DER GRENZE DES MÖGLICHEN
Im Sinfoniefinale ist die Tonfolge Hauptthema eines Sonatensatzes, also eines musikalischen Geschehens aus Dynamik und Ruhe und Erfüllung (wir könnten auch sagen: aus Werden, Sein und Vergehen). Und dann, als der Sonatensatz eigentlich zu Ende ist, eröffnet die Vierton- Folge – nun kopfüber hängend, harmonisch rätselhaft und im piano – die berühmte Coda, in der Mozart uns seine ganze Kunst zeigen will. Alle Themen des Satzes kombiniert er kontinuierlich, bis er alles zu einer Art «kompaktem Würfel» gefügt hat, wie es der Musikwissenschaftler Peter Gülke formuliert. So staunenswert dies ist – musikalischer Fortgang, gestaltete Zeit wie im Sonatensatz zuvor, seien so nicht mehr möglich; Mozart «komponiert an die Grenze des hier Möglichen heran, jenseits ihrer gibt es nichts zu holen» (Gülke).
Die Klimax leuchtet nur kurz auf, ohne Bombast; bald löst sich der «Würfel», und der Satz schliesst heiter. Zuvor aber haben wir vielleicht kurz in die Unendlichkeit geblinzelt, in den wenigen Takten, wo Mozart es schafft, höchste Kunstfertigkeit und mitreissende Musik, Denken und Fühlen, Werden und Vergehen zusammenzubringen. Zugegeben, am Vergehen der Zeit ändert das nichts. Aber lassen wir uns doch von Peter Gülke dazu ermutigen, «in grossen Momenten der Musik Unabhängigkeit vom gefrässigen Zeitlauf mitzuhören».
Felix MichelHANNAH KENDALL
He stretches out the north over the void and hangs the earth on nothing
«He stretches out the north over the void and hangs the earth on nothing» (Er streckt den Norden über die Leere aus und hängt die Erde an das Nichts) ist sowohl von Schumanns Sinfonie Nr. 2 als auch von Mozarts «Jupiter»-Sinfonie inspiriert, was mich zu dem Titel führte; dieser ist eine Passage aus dem Buch Hiob, in der über die Grösse und Macht Gottes nachgedacht wird, mit spezifischen Bildern, die sich auf die wundersame Schöpfung des endlosen Kosmos beziehen. Sie erinnerte mich an Jupiter, den Gott des Himmels und des Donners (in einigen Übersetzungen ist «der Norden» gleichbedeutend mit «der nördliche Himmel», und später heisst es in dem Vers: «Wer kann dann den Donner seiner Macht verstehen?»). Sie schien jedoch auch die Empfindungen einer tiefen Verzweiflung zu verkörpern, die an diejenige von Schumann erinnerte, wie er sie in seinen Briefen ausdrückt: Das Gefühl, in einer Leere zu sein, ohne greifbaren Halt zu haben. Dies ist das übergreifende Thema, das ich mit dem Werk zu evozieren versucht habe. Genauer gesagt ist ein ausgedehnter erster Bläsersatz auf einer Reihe von Akkorden aus Schumanns Sinfonie aufgebaut. Tatsächlich werden Motive aus beiden Werken zitiert, und darüber hinaus spielt eine Sammlung vorprogrammierter Spieldosen Mozarts «Ah! vous dirai-je, Maman», ein Thema und Variationen über das englische Schlaflied «Twinkle Twinkle Little Star», das auf die Grenzenlosigkeit des Himmels verweist, aber vor allem nach Licht in einer scheinbar alles verzehrenden Dunkelheit verlangt.
Hannah Kendall
HANNAH KENDALL
Hannah Kendall, in London geboren, studierte Gesang und Komposition an der University of Exeter, wo sie im Hauptfach Gesang und Komposition abschloss. Ausserdem erwarb sie einen Master-Abschluss am Royal College of Music, wo sie bei Kenneth Hesketh studierte, sowie einen Master-Abschluss in Kunstmanagement am Royal Welsh College of Music and Drama in Cardiff. 2015 gewann Kendall einen «Women of the Future Award» in der Kategorie Kunst und Kultur. Im Rahmen des Schleswig-Holstein Musik Festivals wurde ihr der Hindemith-Preis 2022 verliehen aufgrund ihrer «enormen kompositorischen Vielfalt, die von klassischem Erbe bis hin zu experimentellen Ideen reiche». Dazu sagt Kendall: «Suggestive Bilder innerhalb dramatischer Konstrukte bilden die Hauptbestandteile meines Kompositionsstils. Manchmal greife ich auf Aspekte meines afrikanisch-karibisch-europäischen Erbes zurück. Ich versuche, Wege zu einem tieferen Verständnis zu finden, wie kulturelle Entdeckungen die Ästhetik meiner Musik beeinflussen können.»
ROBERTO GONZÁLEZ-MONJAS
Roberto González-Monjas ist ein äusserst gefragter Dirigent und Geiger, der sich international rasch einen Namen machte. Er ist Chefdirigent des Musikkollegium Winterthur und Chefdirigent des Mozarteumorchesters Salzburg. Zudem wirkt er als Erster Gastdirigent des Belgian National Orchestra und Chefdirigent des Symphonieorchesters von Galicien in Spanien. Die Dalasinfoniettan in Schweden ernannte ihn nach vier Jahren als Chefdirigent zum Ehrendirigenten. Als engagierter Pädagoge und Förderer einer neuen Generation talentierter Musiker hat Roberto González-Monjas zusammen mit dem Dirigenten Alejandro Posada 2013 die Iberacademy gegründet. Ihr Ziel ist es, ein effizientes und nachhaltiges Modell der musikalischen Ausbildung in Lateinamerika zu schaffen, das sich auf benachteiligte Bevölkerungsschichten konzentriert – und hochtalentierte junge Musiker:innen fördert. Er ist zudem Professor für Violine an der Guildhall School of Music & Drama und ist regelmässig Mentor und Dirigent des Guildhall School Chamber and Symphony Orchestra in der Barbican Hall, London. Zuvor war Roberto González-Monjas sechs Jahre lang Konzertmeister des Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia sowie bis zum Ende der Saison 2020/21 des Musikkollegium Winterthur.
MUSIKKOLLEGIUM WINTERTHUR
Das MMusikkollegium Winterthur wurde 1629 gegründet und ist somit eine der traditionsreichsten musikalischen Institutionen Europas. Winterthur ragt aus der europäischen Kulturlandschaft heraus. Dies nicht nur dank seiner Kunstsammlungen, sondern auch dank seines Orchesters – dem Musikkollegium Winterthur –, das seit 2021/22 unter der Leitung des Chefdirigenten Roberto González-Monjas steht. Die bis ins Jahr 1629 zurückreichende Geschichte des Musikkollegium Winterthur hat lebendige Spuren hinterlassen: Das Engagement der bürgerlichen Familien aus dem 17. Jahrhundert wird heute von den zahlreichen Vereinsmitgliedern weitergeführt.
Prägend ist insbesondere das frühe 20. Jahrhundert geworden. Der Mäzen Werner Reinhart und der Dirigent Hermann Scherchen machten Winterthur zu einem Zentrum des europäischen Musiklebens. Igor Strawinsky, Richard Strauss und Anton Webern verkehrten hier, auch Clara Haskil oder Wilhelm Furtwängler. Ein verpflichtendes Erbe: Kein anderes klassisches Sinfonieorchester der Schweiz widmet sich dem zeitgenössischen Musikschaffen so selbstverständlich wie das Musikkollegium Winterthur. Dazu kommen Uraufführungen, in jüngster Zeit von Richard Dubugnon, Helena Winkelman, David Philip Hefti, Matthias Pintscher, Andrea Tarrodi und Arash Safaian. Die weiteren Repertoire-Schwerpunkte liegen in der Klassik und frühen Romantik. Aber auch auf grosse Sinfonik – etwa von Brahms, dem eine neuere CD-Einspielung gilt – wirft das agile Orchester gerne frisches Licht. In Opern- und Ballettproduktionen ist es ebenfalls regelmässig zu erleben. Mit über 40 Saisonkonzerten, seinem vielseitigen Musikvermittlungs-Angebot sowie spartenübergreifenden Formaten tritt das Orchester hervor. Zur hohen Qualität des Klangkörpers beigetragen haben viele: ehemalige Chefdirigenten wie Franz Welser-Möst, Heinrich Schiff oder Thomas Zehetmair, langjährige Gastdirigenten wie Heinz Holliger, Reinhard Goebel und Michael Sanderling, aber auch international gefragte Solistinnen und Solisten, die stets gerne zum Musikkollegium Winterthur zurückkehren. So sind unter anderem Andreas Ottensamer, Barbara Hannigan, Sir András Schiff, Ian Bostridge oder Carolin Widmann regelmässig in Winterthur zu Gast.
ANDERE ALBEN AUS DIESER „SÉRIE“
„Auch wenn man Musik nicht vollständig verstehen muss, ist es faszinierend, die Geheimnisse hinter musikalischen Meisterwerken zu entschlüsseln.“
Das Thema unserer Saison 22/23, „Werden“, ist direkt aus Mozarts großartiger Symphonie Nr. 39 entnommen. Dieses Werk wird mit Begriffen wie Freimaurerei, Virtuosität, Natur, Geheimnis und Erleuchtung in Verbindung gebracht. Aber warum? Kann Musik diese Ideen wirklich ausdrücken, oder assoziieren wir nur willkürlich romantische Bedeutungen mit ihr? Wie können wir ein Manuskript interpretieren, das 1788 bei Kerzenlicht eilig mit Tinte auf Pergament geschrieben wurde? Ich lade Sie herzlich ein, sich mit den verborgenen Aspekten dieses faszinierenden Werks zu beschäftigen.
"Sein" Works by Mozart - Syrse - Haydn
by Mozart - Syrse - Haydn
Der Chefdirigent des Musikkollegiums Winterthur, Roberto González-Monjas, nahm die drei letzten Sinfonien, die Mozart im Sommer 1788 in rascher Folge komponierte, zum Anlass für dieses gross angelegte saisonale Triptychon. Während die erste Sinfonie (Nr. 39) in Es-Dur eine langsame Einleitung hat, endet die letzte (Nr. 41), die so genannte „Jupiter-Sinfonie“, mit einem atemberaubenden Finale, so dass „Anfang“ und „Ende“ - ja, sagen wir „Werden“ und „Überschreiten“ - zum künstlerischen Konzept dieser Trilogie gehören. Die zentrale g-Moll-Sinfonie (Nr. 40) steht für das „Sein“: für das „im Zentrum sein“.
[Weitere Alben des Musikkollegiums Winterthur anzeigen]
Return to the album | Read the booklet | Composer(s): Various Composers | Main Artist: Roberto González-Monjas







 "Werden" Works by Mozart - Beethoven - Tarrodi
"Werden" Works by Mozart - Beethoven - Tarrodi